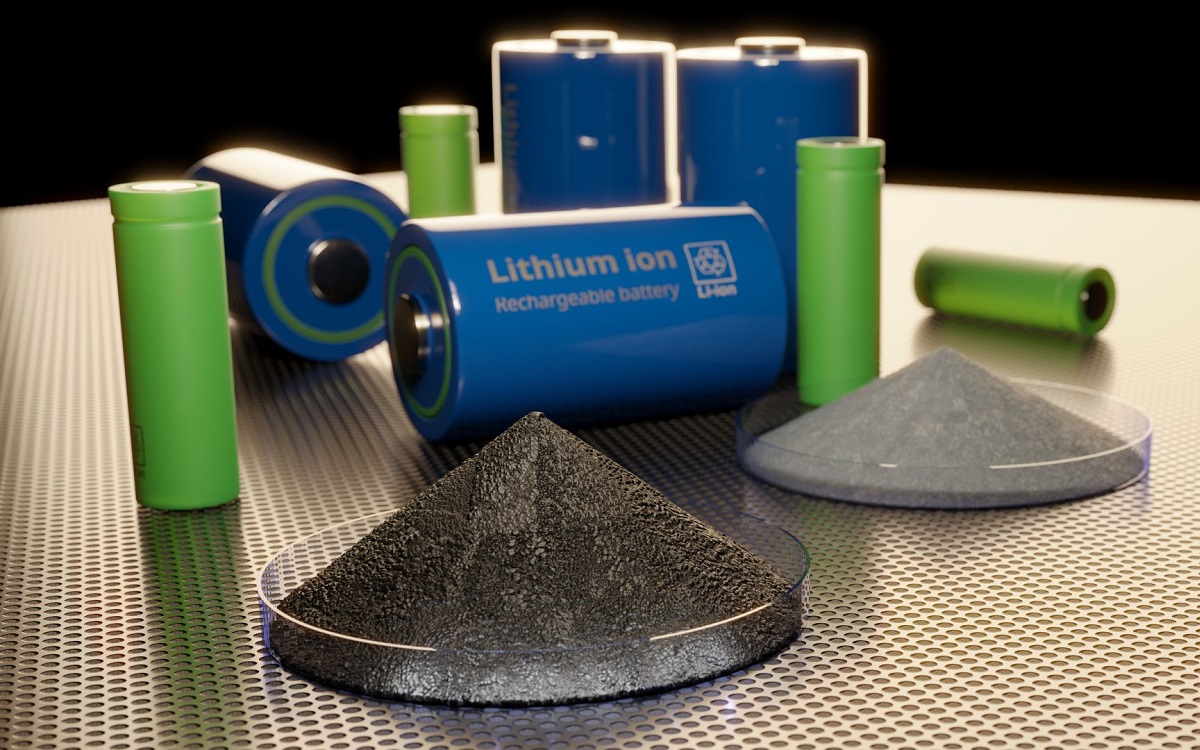12.04.2023 Ι Forschende vom EU-Projekt North Sea Wrecks (NSW) tauchten zu Weltkriegswracks in der Nordsee und analysierten Proben. In einem öffentlichen Symposium am 19. und 20. April im Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) stellt das vom Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) / Leibniz-Institut für Maritime Geschichte geleitete EU-Projekt nach viereinhalb Jahren Ergebnisse vor.
Wie bedenklich sind die Munitionsreste zweier Weltkriege, die noch immer in alten Wracks am Grund der Nordsee und anderen Meeren liegen? Welche konkreten Gefahren gehen von Kriegswracks, versunkener Munition (UXO) und Chemikalien wie TNT im Wasser aus? Das EU-geförderte, internationale Projekt „North Sea Wrecks“ ging diesen Fragen nach und untersuchte, inwieweit Munition im Meer eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt.
Tonnenweise Munition in der Nordsee
Die beteiligten Meeresforschungsinstitute in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark sind auf mehreren Forschungsausfahrten in der Nordsee gewesen. Westlich vor Helgoland wurden beispielsweise mit dem Forschungsschiff HEINCKE des Alfred-Wegener-Institut Proben an der SMS MAINZ und der SMS ARIADNE genommen, die dort im Ersten Weltkrieg sanken. Die SMS MAINZ ist nur eines von vielen Wracks, in denen noch Kriegsgerät, Waffen und giftige Munitionsreste lagern, die in die Meeresumwelt gelangen könnten. Allein im deutschen Teil der Nordsee sind es Schätzungen zufolge rund 1,3 Millionen Tonnen Munition, aus denen durch Korrosion gefährliche Schadstoffe austreten können.
“Nach viereinhalb Jahren endet unser Projekt jetzt mit wichtigen Ergebnissen, die wissenschaftlich, politisch sowie historisch aufgearbeitet werden müssen“, sagt Dr. Sven Bergmann, Kulturanthropologe am DSM und Kurator der NSW-Ausstellung.
„Rund um die Wracks sind die Konzentrationen von gelöstem TNT teilweise deutlich erhöht. Die Chemikalien sind giftig und krebserregend und sie werden von den Organismen vor Ort aufgenommen. Wir versuchen herauszufinden, welche Effekte das auf die Tiere hat“, ergänzt Dr. Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut, der die Expeditionen zu den Deutschen Wracks leitete und die Gesundheitsuntersuchungen an den Organismen durchführt.
Zukünftiger Umgang mit Weltkriegsaltlasten
Das NSW-Team stellt die Ergebnisse am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. April, in einem Symposium in den Räumen des Alfred-Wegener-Instituts der interessierten Öffentlichkeit vor. Während der zweitägigen, hybriden Veranstaltung in englischer Sprache erläutern internationale Expert:innen die Arbeitsweise, die Forschungsergebnisse und die im Projekt entwickelten Instrumente zur Risikobewertung. Die beteiligten Wissenschaftler:innen und weitere Expert:innen laden Interessierte herzlich dazu ein, gemeinsam ins Gespräch darüber zu kommen, wie der zukünftige Umgang mit den Herausforderungen durch versenkte Weltkriegsaltlasten sein sollte. Hier finden Sie das Programm.
„Wir freuen uns darüber, dass der Abschluss des Projekts und die Präsentation der Ergebnisse dort stattfinden, wo alles begann – in Bremerhaven. Zusammen mit unserem Partner, dem Alfred-Wegener-Institut, möchten wir der örtlichen Bevölkerung die Möglichkeit geben, mit dabei zu sein. Auf den Messen und Veranstaltungen, die wir mit der im Projekt entwickelten Wanderausstellung besuchten, gab es jedes Mal sehr viel Interesse an dem Thema – ob Schülerinnen und Schüler oder Seniorinnen und Senioren, die Menschen hatten viele Fragen“, sagt Bergmann.
Im vergangenen Jahr tourte das NSW-Team mit einer mobilen Pop-up-Wanderausstellung durch die Partnerländer Dänemark, Belgien, Norwegen, die Niederlande und Deutschland und sensibilisierte Interessierte aller Generationen für das Thema Weltkriegsaltlasten. Derzeit gastiert die Ausstellung bis 16. April im Deutschen Marinemuseum Wilhelmshaven. Zukünftig ziehen die Medienstationen in die neue Dauerausstellung im Erweiterungsbau des DSM, die 2024 eröffnet.
An North Sea Wrecks beteiligte Partner
North Sea Wrecks ist ein europäisches, interdisziplinäres Projekt mit einem Budgetrahmen von fünf Millionen Euro, das von der EU über das Programm Interreg gefördert wird. Involviert sind neben dem DSM acht Projektpartner aus fünf Ländern. Als Partner sind beteiligt: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (Deutschland); Vlaams Instituut voor de Zee (Belgien); Aarhus University – Department of Geoscience (Dänemark); Stichting NHL Stenden Hogeschool – Maritiem Instituut Willem Barentsz (Niederlande); north.io GmbH (Deutschland); Periplus Consultancy BV (Niederlande); Forsvarets Forskningsinstitutt (Norwegen) und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler (Deutschland).
Zur Projektseite