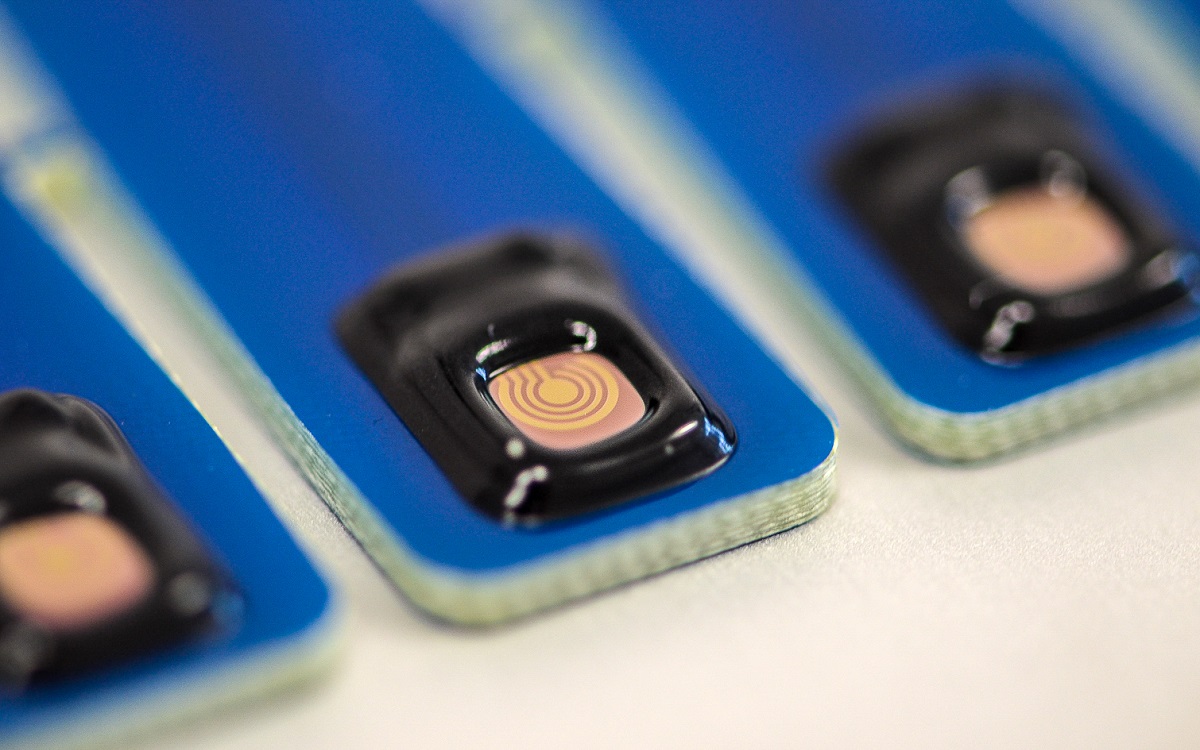29.11.2022 Ι Auf der Weltklimakonferenz diskutierten Forschende und Expert:innen aus aller Welt die Rolle der Kohlendioxid-Entnahme aus der Atmosphäre. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung fördert zwei Programme mit insgesamt 48 Millionen Euro.
Vom 6. bis 18. November 2022 fand die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Scharm el-Sheich, Ägypten, statt. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF) lud Wissenschaftler:innen der Forschungsprogramme CDRterra und CDRmare ein. Sie diskutierten die Rolle der Kohlendioxid-Entnahme aus der Atmosphäre mit Expert:innen.
Austausch von Wissenschaft und Politik ist notwendig
Prof. Julia Pongratz, Programmkoordinatorin des Programms CDRterra, und Prof. Gregor Rehder, Sprecher des Forschungsprogramms CDRmare, präsentierten zu Beginn der Veranstaltung das gesamte Spektrum an Forschungsfragen und -aktivitäten zu marinen und landbasierten CO2-Entnahmemethoden. Lukas Fehr von der LMU-München moderierte die Diskussion um den Ansatz der CO2-Entnahme. Im Fokus der Diskussion stellten Prof. Pongratz, Prof. Rehder, Dr. Jessica Strefler (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK) und Dr. Oliver Geden (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Fragen nach der politischen Umsetzung der CO2-Entnahme, der Skalierbarkeit und den Potenzialen der verschiedenen Methoden.
Es herrschte Einigkeit, dass eine offene Debatte mit der Bevölkerung geführt werden müsse. Dafür müssten Wissenschaft und Politik in einen offenen Austausch treten. Auch müssten die Hindernisse, die der Umsetzung der CO2-Entnahme im Wege stehen, regelmäßig neu bewertet werden. Zudem gebe es kein „Entweder-Oder”, wenn es um CO2-Entnahmethoden gehe. Wissenschaftlich klar ist, dass eine Kombination von marinen und landbasierten Methoden benötigt wird.
Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre erforderlich
Die internationale Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen verpflichtete sich im Jahr 2015, die Erderwärmung auf maximal 2 °C, besser 1,5 °C, zu begrenzen. Die jüngsten Berichte des Weltklimarats setzen in allen Szenarien, die das 1,5 °C-Ziel einhalten, den Einsatz der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre voraus.
Deutschland setzte sich zum Ziel bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu sein. Das bedeutet, dass die CO2-Emissionen drastisch und schnell reduziert werden müssen. Es werden jedoch auch bei sehr ehrgeiziger Emissionsminderung sogenannte „Rest-Emissionen” verbleiben, die sich nicht oder nur sehr schwer vermeiden lassen. Um diese auszugleichen oder Temperaturüberschreitungen wieder zurückzuführen, sind „negative Emissionen” nötig. Dies gelingt durch die aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und die anschließende dauerhafte Speicherung von CO2 in geologischen Speichern. Das können besipielsweise Ozeane oder Biomasse, etwa Wälder, sein. Die dafür notwendigen Prozesse benötigen allerdings noch Aufmerksamkeit.
CO2-Entnahmemethoden werden erforscht
Wie CO2-Entnahmemethoden im großen Umfang umgesetzt werden können, wird in zwei BMBF-Forschungsprogrammen zu CO2-Entnahmemethoden an Land und im Meer erforscht. Das Forschungsprogramm CDRterra konzentriert sich auf CO2-Entnahmemethoden an Land. Dabei schauen die Forschenden auch auf mögliche verstärkende oder störende Effekte, wenn Methoden kombiniert werden. Wie viel CO2 entnommen werden kann und wie eine dauerhafte Bindung des CO2 gelingt, sind zentrale Aspekte des Programms. Darüber hinaus wird eine wissenschaftliche Gesamtsynthese aller CO2-Entnahmethoden erarbeitet.
Die Forschungsmission CDRmare widmet sich den Untersuchungen zu Methoden im Meer. Dabei ist die größte Frage, inwieweit der Ozean eine Rolle bei der Entfernung und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre spielen kann. Darüber hinaus werden die Zusammenhänge mit der Meeresumwelt, dem Erdsystem und der Gesellschaft und die Auswirkungen auf diese untersucht. Hinzu kommt die Suche nach geeigneten Ansätzen für die Überwachung, Erfassung und Bilanzierung der Kohlenstoffspeicherung im Meer. Dabei wird die sich verändernde Umwelt beachtet.
Weitere Informationen